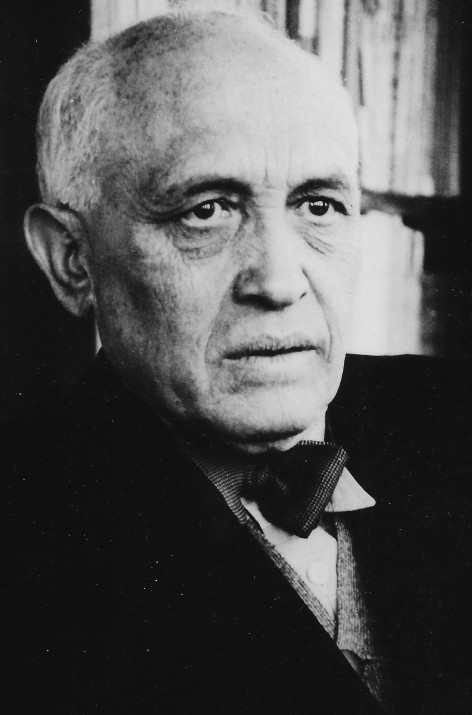
«Ohne Freiheit kann der Geist nicht leben. Ein dem Staate versklavtes Volk wird kein Mehrer der Kultur sein. Das Dritte Reich ist eine Festung in dauerndem Belagerungsstand, die in ihrem Bereiche nur duldet, was ihren unmittelbaren Zwecken dient. Der Einzelne hat keine Verfügung über sich. Mit eiserner Hand leitet der Staat den Menschen durch das Leben, damit er ihm als willenloses Werkzeug dient.» Klarer als Jonas Fränkel hat in der Schweiz kein Zeitgenosse den Nationalsozialismus verdammt. Weshalb es ganz und gar unglaublich ist, dass die Schweiz diesen Philologen seines Judentums wegen kaltstellte, als lebte er im Dritten Reich. Als Will Vesper, Hitlers ergebendster Literat, 1936 in der «Neuen Literatur» forderte, die Gottfried-Keller-Ausgabe müsse «den störrischen Händen des jüdischen Herausgebers entwunden werden», rannte er in der Schweiz jedenfalls offene Türen ein. Er war unter helvetischen Fachgenossen von Anfang an verhasst gewesen, am 12.August 1889 in Krakaus geborene und am 4.Juni 1965 in Riedegg bei Thun verstorbene, seit 1909 als Privatdozent in Bern lebende Jonas Fränkel. Die Autorisation der Zürcher Regierung hatte er nur erhalten, weil die Editionen von Ermatinger, Maync und Nussberger wissenschaftlich indiskutabel waren. Zugang zum Keller-Nachlass bekam er aber auch dann erst, als er sich verpflichtete, Ermatingers Edition der Keller-Briefe nicht zu kritisieren! Fränkel arbeitete, durch dauernde Rechtsstreitigkeiten zermürbt, langsamer als seine Vorgänger – 1939 lagen von insgesamt 24 erst 17 Bände fertig vor –, aber er war sachlich derart unanfechtbar, dass man ihm nur mit persönlichen Angriffen beikommen konnte. 1912 bereits war er in Dominik Müllers Basler Zeitschrift «Der Samstag» als «Literaturjude» und «hergewehter Asiate» beschimpft worden, von dem man sich die grossen Schweizer Dichter nicht vermitteln lasse. Als 1933 im Reich der Antisemitismus hoffähig wurde, stellte man sich nicht etwa schützend vor den Beschimpften, sondern vollzog auf kaltem Weg, was der Führer befahl. Martin Bodmers «Corona» legte 1938 dem Heft mit dem Briefwechsel Keller-Vieweg einen Zettel bei, auf dem sie sich vom Herausgeber Fränkel distanzierte. Im Zürcher Kantonsrat fiel Regierungsrat Hafner 1941 über Fränkels mutiges Buch «Gottfried Kellers politische Sendung» her und zitierte das ominöse Wort von der «hebräischen Bosheit». Max Nussberger aber durfte im Mai1942 im Zürcher «Volksrecht» ungestraft schreiben, mit seiner Edition arbeite Fränkel «seit 20 Jahren daran, die Werke Kellers ins Hebräische zu übersetzen»! So kam denn alles, wie es kommen musste. Die Zürcher Regierung zwang Fränkel zum Verzicht auf die Herausgeberschaft und setzte 1942 den im Reich unverdächtigen Carl Helbling zu seinem Nachfolger ein. Und nicht viel anders erging es Fränkel mit der Spitteler-Werkausgabe, welche ihm der Dichter noch selbst übertragen hatte. Nach jahrelangen Intrigen betraute Bundesrat Etter 1944 nicht Fränkel, sondern dessen Gegenspieler Altwegg, Faesi und Bohnenblust mit der «ehrenvollen nationalen Aufgabe». 1927, es ging um die Benützung des Keller-Archivs durch Fränkel, befürwortete SSV-Präsident Moeschlin Karl Naef gegenüber die völlige Freigabe: «Sonst behält der Kerl schliesslich noch das moralische Recht auf seiner Seite.» – Eine Befürchtung, die sich voll bewahrheitet und der Schweizer Germanistik eine schwere, noch immer nicht abbezahlte Hypothek hinterlassen hat. Die Liste derer aber, die sich für Fränkel eingesetzt haben, liest sich im nachhinein wie die Ehrengalerie unbestechlicher Zeitgenossen der Kriegs- und Nachkriegsjahre: C.A. Loosli, Alfred Fankhauser, Otto Zinniker, Robert Mächler, Fritz Schwarz, Karl Adolf Laubscher, Rudolf Jakob Humm, Paul Schmid-Ammann, Werner Schmid, Xaver Schnieper.
Fränkel, Jonas
*Krakau (Polen) 12.8.1879, Hünibach (BE) 4.6.1965, Germanist. F. war seit
1909 PD, seit 1921 a.o. Prof. für dt. Literatur an der Univ. Bern. Der
internat. anerkannte Philologe beriet C. Spitteler bei der Abfassung seiner
letzten Werke freundschaftl. und wurde von diesem zum Biographen und Hg. seiner
ges. Werke bestimmt. Ab 1926 konnte er im Auftrag der Zürcher Regierung
auch mit der ersten wiss. Gesamtausgabe der Werke G. Kellers beginnen. Intrigen
seiner schweiz. Konkurrenten sowie ein latenter Antisemitismus, der sich ab 1933
seiner jüd. Abstammung wegen gegen ihn auswirkte, verhinderten jedoch in
einer Zeit geistiger Enge, dass F. seine Projekte realisieren konnte. Die
Keller-Ausgabe wurde nach Abschluss von 17 Bde. 1942 C. Helbling
übertragen, die Spitteler-Werkausgabe realisierten W. Altwegg, R. Faesi und
G. Bohnenblust ab 1944 im Auftrag von BR P. Etter, der F. auf prozessualem Weg
von der Aufgabe ausgeschlossen hatte. F., auch als Polemiker meisterhaft,
verteidigte sich in versch. Schriften wie »Die Gottfried-Keller-Ausgabe
und die Zürcher Regierung« (1942) oder »Spittelers Recht«
(1946). Gültigsten Ausdruck fand seine engagierte Philologie 1939 in der
gegen den Nat.-Soz. gerichteten Schrift »Gottfried Kellers polit.
Sendung«. (Schweizer Lexikon CH 91)
Jonas Fränkel, Gottfried Keller und Carl Spitteler
Keller war für die Schweizer nicht seines «Martin Salander» und
der darin enthaltenen bitterbösen Gesellschaftskritik zur nationalen
Identifikationsfigur und zu einem Autor geworden, über dessen
Einschätzung und Wertschätzung das Volk und die politischen Parteien
aller Couleur mitzubestimmen sich das Recht nahmen. Womit die Schweizer Keller
identifizierten, waren nebst dem Gemütswert des kleinwüchsigen, treu
dem Staat dienenden und ab und zu eins über den Durst trinkenden Originals
die Novelle «Das Fähnlein der sieben Aufrechten» mit ihrem
gloriosen Schützenfest sowie «O mein Heimatland», das Lied, das
bis zum Beginn des Popzeitalters ernsthaft im Gespräch stand, an Stelle des
von «Rufst du mein Vaterland» oder (später) «Trittst im
Morgenrot daher» schweizerische Nationalhymne zu werden. Und nicht
viel anders verhielt es sich mit dem zweiten Dichter, den Jonas Fränkel als
Herausgeber und potentieller Biograph bearbeitete, mit Carl Spitteler. Auch wenn
der Dirigent Felix Weingartner ihn 1904, im Erscheinungsjahr des letzten Teils
von «Olympischer Frühling», in Deutschland und Österreich
zum «künstlerischen Ereignis» emporstilisiert hatte und Josef
Viktor Widmann nicht müde wurde, im «Bund» und in den grossen
Zeitungen Wiens seinen Jugendfreund und dessen artistische Epik als epochales
literarisches Phänomen zu feiern («Gewaltig wie keiner mehr seit
Goethe»), war dieser Spitteler zumindest bis 1914 ein Autor für
Insider und einen kleinen Kreis Eingeweihter gewesen, für Insider bzw.
für rückwärtsgewandte Idealisten, die mitten in der Umbruchzeit
der Industrialisierung und der beginnenden Massenkultur eine gegen die
Zerfallserscheinungen von Naturalismus und Moderne gerichtete Symbolfigur der
überzeitlich ewigen, streng formgebundenen und traditionsverpflichteten
idealistischen Dichtung in ihm sahen. Bis seine überraschende Rede
«Unser Schweizer Standpunkt», gehalten am 14. Dezember 1914 vor der
Sektion Zürich der «Neuen Helvetischen Gesellschaft», den
Repräsentanten einer antikisierenden Epik über Nacht zum politischen
Literaten stempelte und ihm – u. a. durch die Aktivitäten von Romain
Rolland – als einem unerschrockenen (und ziemlich missverstandenen)
Kämpen gegen den deutschen Imperialismus den Literaturnobelpreis des Jahres
1919 einbrachte. Von da an verhielt es sich mit Spitteler wie mit Gottfried
Keller, und niemand, der einen schweizerischen literarischen Lehrstuhl innehatte
oder auf einen solchen spekulierte, konnte es sich noch leisten, den zu
internationalem Ruhm Gelangten zu ignorieren bzw. nicht wenigstens eine
grundlegende wissenschaftliche Studie über ihn vorgelegt zu haben. Denn
erklärungsbedürftig war er aller Euphorik und allen Festreden zum
Trotz eben doch, der formversessene Olympier, und abgesehen vom ziemlich
untypischen, gegen die schweizerische Behäbigkeit gerichteten, auf eigenen
bitteren Erfahrungen basierenden Roman «Imago», den süsslichen
«Mädchenfeinden» und der Ballade von den «jodelnden
Schildwachen» las ihn ausserhalb des erwähnten Kreises nach wie vor
kaum jemand.
Das aber hatte nicht zu interessieren, als Ende der dreissiger Jahre der
katholisch-konservative Bundesrat Etter und seine geistige Landesverteidigung
nationale Identifikationsfiguren für den schweizerischen
Selbstbehauptungswillen brauchten. Wer war dazu besser geeignet als der einzige
Literaturnobelpreisträger, den die Schweiz je hervorgebracht hatte und der
1914, in einem Moment höchster Bedrohung, für den Zusammenhalt des
Landes eingetreten war? Dem Schweizerischen Schriftstellerverein, der 1914 unter
Ernst Zahn eine zu Spitteler in extremem Gegensatz stehende prodeutsche Haltung
eingenommen hatte, war es in taktisch kluger Zusammenarbeit zwischen dem
ehemaligen Präsidenten Robert Faesi und dem aktuellen Vorsitzenden Felix
Moeschlin gelungen, Spittelers Töchter zur Überantwortung des gesamten
Nachlasses des 1924 Verewigten an die Eidgenossenschaft zu bewegen. Damit war
der Weg zu einer nationalen Spitteler-Ausgabe aber noch nicht frei, hatte der
Verblichene doch ärgerlicherweise ausdrücklich den jüdischen
Privatdozenten Jonas Fränkel zu seinem Nachlassverwalter und
Willensvollstrecker erklärt – und mit dem zusammen waren jene
Professoren, die der Schriftstellerverein dem Bundesrat unter Vorgabe rein
sachlicher, literaturpolitischer und nationaler Argumente als Herausgeber einer
nationalen Spitteler-Gesamtausgabe empfahl, nach deren teilweise deprimierenden
Erfahrungen mit ihren Gottfried-Keller-Bemühungen (Details folgen noch)
niemals unter einen Hut bzw. an den Sitzungstisch einer Editorenkommission zu
bringen.
Der Kampf um Spitteler war härter als erwartet und schwieriger zu gewinnen
als derjenige um Gottfried Keller, aber zu des Dichters hundertstem Geburtstag
konnte 1945, zwei Jahre, nachdem Fränkel die Gottfried-Keller-Ausgabe
entrissen worden war, der erste Band der zehnbändigen «Gesammelten
Werke» erscheinen. «In einer Zeit, in der Altes zusammenbricht und
Neues in harten Geburtswehen liegt», hiess es in Philipp Etters
Geleitwort, «haben Carl Spittelers urgewaltige Visionen der blutenden und
leidenden, aber einer neuen Auferstehung harrenden Menschheit Wesentliches zu
künden.»
Wer mehr als ein halbe Jahrhundert später auf diesen editorischen Effort
zurückblickt und sich den Blick weder durch nationale noch durch
bildungsphilisterliche noch durch opportunistische Gesichtspunkte trüben
lässt, wird konstatieren müssen, dass der politisch-nationale
Stellenwert des Verfassers von «Unser Schweizer Standpunkt» nicht,
wie angestrebt, mit seinem Rang und seiner Bedeutung als Dichter zur Deckung
gebracht werden konnte. Als Verfasser von mythologisierenden Epen ist Spitteler,
Nobelpreis hin oder her, auch in den vergangenen fünfzig Jahren nicht zum
Allgemeingut des schweizerischen Lesepublikums geworden, und angesichts der
europäischen Integrationsbewegung, der sich die Schweiz auf Dauer nicht
wird verweigern können, dürfte bald einmal auch die weitgehend als
isolationistisch rezipierte politisch-nationale Dimension seines Denkens und
Wirkens bloss noch von historischem Interesse sein.
Man könnte den einstmals hochgelobten Olympier ohne grosses Bedauern der
Literaturgeschichtsschreibung überlassen und ernüchtert zur
Tagesordnung übergehen, wäre da nicht noch ein mit der
Spitteler-Rezeption unablösbar verbundenes Phänomen, das, mit hundert
Fragezeichen versehen, unaufgearbeitet auf uns gekommen ist und das, sollte des
Rätsels Lösung je gefunden werden, die ganze Angelegenheit in ein
neues, völlig anderes Licht stellen könnte: die Kaltstellung des von
Spitteler selbst als Nachlassverwalter, Herausgeber und Biograph vorgesehenen
Jonas Fränkel bzw. die Folgen, die diese Aktion für die Werkausgabe,
deren Rezeption und für die Einschätzung Spittelers durch die Nachwelt
gehabt hat. Was wiederum von jenem anderen «Rausschmiss», demjenigen
in Sachen Gottfried Keller, nicht isoliert gesehen werden kann.
So komplex der ganze Fall Keller/Spitteler/Fränkel ist, so unbestreitbar
scheint er mit zwei schwer zu analysierenden und schwierig auszuleuchtenden
Problemkreisen zusammenhängen: mit dem helvetischen Antisemitismus sowie
mit dem Cliquenwesen und Konkurrenzneid unter den schweizerischen Professoren.
1913 schon, also noch zu Spittelers Lebzeiten, scheinen die Weichen, die am Ende
zu Fränkels Ausbootung führten, auf fatale Weise gestellt gewesen zu
sein. Damals, als Fränkel seinen Plan einer Spitteler–Biographie
bekanntgab, verbreitete der «Semi-Kürschner», das
berüchtigte antisemitische Literaturlexikon, einen Satz aus Dominik
Müllers Basler Zeitschrift «Der Samstag», wo es am 6. April
1912 geheissen hatte: «Fränkel als solcher ist Wurst, aber ein Jude
uns unsere grossen Dichter vermitteln! Merci vielmals!» So deutlich wurden
die ehrbaren Professoren, Schriftstellervereinsfunktionäre, Juristen,
Politiker und Beamte, die Fränkel in den zwanziger und dreissiger Jahren
aufs Abstellgleis zu schieben suchten, sieht man von den eingangs zitierten
Ausnahmen ab, natürlich nicht, weder im Falle Spittelers noch in demjenigen
Gottfried Kellers.
Nein, Jonas Fränkel ist nicht als Jude beschimpft worden. Was ihm immer
wieder angekreidet wurde, waren seine Schwerhörigkeit, sein
«störrisches Wesen», seine Akribie und langsame Arbeitsweise
und vor allem seine polemische Begabung, die ihm jede Menge Feinde geschaffen
habe.
Wobei zumindest letzteres nicht unverständlich ist, wenn man seine
kritischen Aufsätze Revue passieren lässt.
Jonas Fränkel war tatsächlich ein Polemiker von einer Schärfe,
einer Treffsicherheit und einer argumentativen Virtuosität, wie es ihn in
diesem Lande vor ihm nicht gegeben hat und wie es ihn leider, leider auch heute
nicht mehr gibt. Und tatsächlich wird der tödliche Hass, mit dem ihn
die Ordinarien von Zürich und Basel, Ermatinger und Nussberger, sowie deren
Schüler, Freunde und Günstlinge verfolgten, nur verständlich,
wenn man Fränkels kritische Essays über deren editorische und
biographische Bemühungen kennt, in denen ihnen auf überzeugende und
unwiderlegbare Weise jegliche Befähigung für ihr Tun abgesprochen
worden ist. Eine Schlüsselrolle spielt dabei Fränkels Rezension von
Ermatingers Neufassung von Jakob Baechtolds Keller–Biographie bzw. der
ebenfalls von diesem neu herausgegebenen Keller-Briefe in den
«Göttingischen gelehrten Anzeigen» vom Dezember 1916, in
welcher Fränkel anhand von zahllosen, in ihrer Mehrheit geradezu
lächerlichen Fehlern des Herausgebers und Biographen hieb- und stichfest
nachweist, dass «die Neubearbeitung des Baechtoldschen Werkes»
«in die Hände eines hierzu Nichtberufenen gelegt worden ist».
Was, welch ein Affront!, zum einen zur Folge hatte, dass die Zürcher
Regierung den 1879 in Krakau geborenen, seit 1909 als Privatdozent in Bern
lebenden Jonas Fränkel – und nicht Emil Ermatinger! – zum
Herausgeber der grossen wissenschaftlichen Gottfried-Keller-Gesamtausgabe
berief, zum andern aber auch zugleich das vorzeitige Ende von dessen
akademischer Karriere bedeutete. Wo immer sich Fränkel, mehrfach von Carl
Spitteler empfohlen und unterstützt, um eine Professur bewarb, wurde er
«seines polemischen Temperaments wegen» abgewiesen, obwohl es damals
kaum einen amtierenden Lehrstuhlinhaber gab, der ihm fachlich-wissenschaftlich
das Wasser hätte reichen können. Was Fränkel, der in ebenso
unschweizerischer wie undiplomatischer Weise frank und ohne Rücksicht auf
Verluste alles, was er für richtig erkannt hatte, offen heraussagte, nicht
hinderte, weiterhin kritisch tätig zu sein. Am brillantesten,
vernichtendsten und folgenreichsten im Jahre 1928 im 29. Band der Zeitschrift
«Euphorion», wo er die Keller-Ausgaben der Professoren Emil
Ermatinger (Zürich), Max Nussberger (Basel) und Harry Maync (Bern) derart
materialreich und überzeugend als dilettantische Fehlleistungen entlarvte,
dass die philologische Kompetenz und die berufliche Reputation der
selbsternannten Keller-Spezialisten für Eingeweihte endgültig
kompromittiert war. Die Konsequenzen – natürlich nicht für die
wohlbestellten beamteten Professoren, sondern für den schonungslos offenen
Kritiker – sind bekannt und gipfelten nach einer jahrelangen Hetzkampagne
in eben jenem Entscheid der Zürcher Regierung von 1942, Fränkel nach
der Fertigstellung von 17 philologisch einwandfreien Bänden zum Verzicht
auf die Herausgeberschaft an der Gottfried-Keller-Ausgabe zu zwingen und den im
Reich unverdächtigen Zürcher Gymnasiallehrer Carl Helbling zu seinem
Nachfolger einzusetzen. Und 1944 dann betraute Bundesrat Etter, wir wir
ebenfalls schon wissen, nicht Fränkel, sondern dessen Gegenspieler Wilhelm
Altwegg, Robert Faesi und Gottfried Bohnenblust mit der «ehrenvollen
nationalen Aufgabe» der Spitteler-Gesamtausgabe.
Spitteler hatte keine testamentarische Verfügung über eine
Gesamtausgabe seiner Werke hinterlassen – welcher Autor würde das
schon tun! –, aber es gibt eine Unzahl unzweideutiger Aussagen des Tenors
von ihm, dass er niemand anderen als den Mann, der schon zu Lebzeiten sein
Famulus und Assistent war, in dieser Rolle bestellt wissen wollte. So schrieb
er, um nur ein einziges, direkt auf das Thema Werkausgabe Bezug nehmendes
Beispiel herauszugreifen, am 22. Juni 1922, als Zürcher Literatenkreise
versuchten, im Zusammenhang mit der vom Verlag Eugen Diedrichs vorgelegten
Werkausgabe einen Gegensatz zwischen ihm und Fränkel zu konstruieren, in
einer Erklärung in der NZZ: «Gerüchten gegenüber, als ob in
Sachen meiner ‘Gesamtausgebe’ Jonas Fränkel eigenmächtig
vorgegangen wäre, im Gegensatz zu mir, erachte ich es als meine Pflicht
festzustellen, dass mein Freund Jonas Fränkel in meiner Angelegenheit
niemals etwas ohne meine Zustimmung unternimmt, und dass er auch in vorliegendem
Falle eine Einwilligung eingcholt hatte... Eines freilich habe ich Jonas
Fränkel vorzuwerfen, dass ich bei diesem Anlass aussprechen will: Er, der
seit mehr als einem Jahrzehnt all sein Dichten und Trachten, alle seine
Mühen und Sorgen in den Dienst seiner Freundschaft zu mir gestellt hat, der
in seinem Eifer für mich sogar davor nicht zurückschreckt, sich
meinetwegen mit aller Welt zu überwerfen, erlaubt mir nicht, ihm für
das alles den mindesten Entgelt oder Gegendienst zu bieten, so dass meine
Dankesschuld, längst schon flnermesslich, sich von Jahr zu Jahr höher
anhäuft.»
Als die Spitteler-Werkausgabe beendet bzw. die sieben zu den 17 von ihm
betreuten noch hinzugekommenen Bände der Gottfried-Keller–Ausgabe
erschienen waren, rettete Fränkel sich nicht in die Resignation, sondern
besprach 1954 im «Euphorion» auch diese Editionsarbeiten mit der
bekannten Unerbittlichkeit und Präzision. Und wie in den früheren
Fällen wurde auch diese Kritik, die den beiden Publikationen auf
unwiderlegbare Weise die schlimmstdenkbaren Fehler und Versäumnisse
nachweisen konnte, von den Betroffenen demonstrativ ignoriert. Aber auch sonst
wurden Fränkels Einwände kaum irgendwo zur Kenntnis genommen, liess
die Fama von seinem unbezähmbaren polemischen Naturell es doch nur als
selbstverständlich und psychologisch verständlich erscheinen, dass der
unterlegene Kandidat nun das Werk seiner glücklicheren Rivalen zu zerzausen
suchte. Die Sachlage ist, wie gesagt, komplex und längst nicht bis in alle
Verästelungen und Details durchschaubar. Und vielleicht waren die
Ermatinger, Faesi, Nussbaumer, Etter, Altwegg, Bohnenblust, und wie sie alle
hiessen, in einer Zeit des extremen äusseren Anpassungsdrucks bloss aus
eigener verdrängter Unsicherheit einem auf entwaffnend-provozierende Weise
offenen, direkten und mutigen Mann wie diesem Jonas Fränkel einfach nicht
gewachsen. Kein Wunder denn, dass die Liste jener, die sich bis zuletzt unbeirrt
für Fränkel einsetzten und das Unrecht, das ihm geschah, mit Namen zu
nennen wagten, sich im Nachhinein wie eine Ehrengalerie unbestechlicher
Zeitgenossen ausnimmt. Es gehörten dazu, um nur die heute dem einen oder
anderen noch geläufigen Namen zu nennen, Carl Albert Loosli, Alfred
Fankhauser, Otto Zinniker, Emil Ludwig, Friedrich Salzmann, Robert Mächler,
Fritz Schwarz, Karl Adolf Laubscher, Rudolf Jakob Humm, Fritz Huber-Renfer, Paul
Schmid-Ammann, Werner Schmid und Xaver Schnieper.
Einer von ihnen, der Schriftsteller Rudolf Jakob Humm, ist sich allerdings erst
1954 bewusst geworden, welches Unrecht Fränkel in den Jahren zuvor
zugefügt wurde, ohne dass er davon weiter Kenntnis gcnommen hätte. So
biss er denn, wie er sich ausdrückte, in der Aprilnummer 1954 seiner
Einmannzeitschrift «Unsere Meinung» in den sauren Apfel und stellte
öffentlich fest, dass er «damals, als die Sache aktuell war»,
sich «nicht die Spur um sie gekümmert» habe. «Ich war so
ahnungslos, wie es heute manche Deutsche von sich behaupten. Ahnungslosigkeit,
das spüre ich heute brennend in mir, ist aber manchmal auch eine
Schuld.»
(Erstdruck in «Quarto», Zeitschrift des Schweizerischen
Literaturarchivs, überarbeitete Fassung)